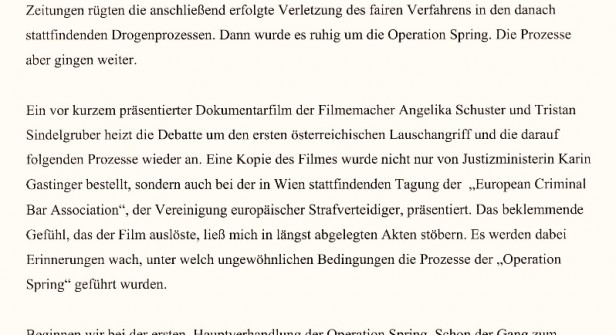Falter 41/05: Die anonyme Justiz.
Wie ein Wiener Strafverteidiger die merkwürdigen Prozesse der Operation Spring erlebt hat. Ein Kommentar von Mag. Josef Phillip Bischof
Vor sechs Jahren kam erstmals der große Lauschangriff zum Einsatz. Eine Sondertruppe des Innenministeriums belauschte und filmte Afrikaner, die sie für Drogendealer hielt. Boulevardmedien lobten den Schlag gegen die „nigerianische Drogenmafia“. Nur wenige Zeitungen rügten die anschließend erfolgte Verletzung des fairen Verfahrens in den danach stattfindenden Drogenprozessen. Dann wurde es ruhig um die Operation Spring. Die Prozesse aber gingen weiter.
Ein vor kurzem präsentierter Dokumentarfilm der Filmemacher Angelika Schuster und Tristan Sindelgruber heizt die Debatte um den ersten österreichischen Lauschangriff und die darauf folgenden Prozesse wieder an. Eine Kopie des Filmes wurde nicht nur von Justizministerin Karin Gastinger bestellt, sondern auch bei der in Wien stattfindenden Tagung der “European Criminal Bar Association“, der Vereinigung europäischer Strafverteidiger, präsentiert.
Das beklemmende Gefühl, das der Film auslöste, ließ mich in längst abgelegten Akten stöbern. Es werden dabei Erinnerungen wach, unter welch ungewöhnlichen Bedingungen die Prozesse der „Operation Spring“ geführt wurden. Beginnen wir bei der ersten Haupt-
verhandlung der Operation Spring. Schon der Gang zum Verhandlungssaal war schwierig, denn eine ungewöhnlich große Menschenmenge hinderte sogar uns Verteidiger daran, bis zum Verhandlungssaal vorzudringen. Ein Großaufgebot an Beamten und Polizeischülern hatte sich zur Lagebesprechung eingefunden. Die Beamten trugen seltsamerweise keine Uniformen, sondern zivile Kleidung. Der Grund für den Aufmarsch: Es sollten sogleich Zeugen erscheinen, die anonym aussagen durften. Normalerweise gibt es solchen Zeugen-
schutz nur in großen Mafiaprozessen. Hier wurde er auch bei Prozessen gegen Straßen-
dealer gewährt. Die Polizeischüler wurden instruiert, sich bei Annähern anonymer Zeugen vor etwaige Pressefotografen und sonstige Schaulustigen zu platzieren oder den ohnedies nicht sehr geräumigen Verhandlungssaal zu besetzen. Nur wenige Journalisten fanden dann noch Platz.Im Gerichtssaal tummelten sich sogar hinter der Verteidigerbank durchtrainierte Beamte des Innenministeriums. Sie trugen schicke, dunkle Anzüge und in den Ohren steckten die Kopf-
hörer kleiner Funkgeräte. Die Beamten schauten auch aus den Fenstern. War es hier wirk-
lich so gefährlich? Oder sollte vor Gericht ein wenig der Eindruck erweckt werden, dass hier nun ganz gefährliche Burschen angeklagt würden? Sollten die Laienrichter, die hier auch zu urteilen hatten, durch ein bedrohliches Szenario beeindruckt werden? Ein Zeuge wurde aufgerufen. Strengstens bewacht führten ihn Polizisten in den Verhandlungssaal. Er trug Overall und am Kopf einen Vollvisierhelm. Niemand sollte erkennen, wer er war. Dabei hing von der Aussage dieses Zeugen ab, ob ein Beschuldigter zu jahrelanger Haft verurteilt oder freigesprochen wurde. Wir Verteidiger fragten uns: Wieso weiß der anonyme Zeuge, der unzählige Personen schwer belastete, so viel von so vielen verschiedenen Beschuldig-
ten und ihrem Treiben zu den unterschiedlichsten Zeiten und Orten? Wir wollten den Zeugen befragen. Doch solche Fragen wurden oft als „unzulässig“ zurückgewiesen. Sie ließen Rückschlüsse auf die Identität des anonymen Zeugen zu, hieß es.Es gab noch andere Beweismittel. Etwa die Protokolle des Lauschangriffes. Wurden die Gespräche korrekt aus dem Igbo ins Deutsche übersetzt? Wer waren die Dolmetscher? Hatten sie all die Gespräche den richtigen Personen zugeordnet? Die Türe des Verhand-
lungssaales öffnete sich. Den Saal betrat schon wieder ein vermummter Mann. Diesmal trug er eine Bankräubermütze mit ausgeschnittenen Sehschlitzen. Hinter der Maske versteckte sich der Dolmetscher. Wir Anwälte fragten den Anonymus, was das Wort „Beeidigung“ bedeute. Er sagt: „Zu Gericht kommen müssen“. Er kannte nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes. Wie konnte er dann all die Protokolle übersetzen? Eine Antwort darauf blieb aus. So ging es dahin. Wochenlang. Monatelang.Und die Gerichtsreporter verloren das Interesse. Und siehe da: auch die Präsenz der Polizei-
schüler und der Männer mit den Funkgeräten ging zurück. Je weniger Kameras und Journalisten desto geringer wurde offenkundig die Gefahr, die von dem organisierten Verbrechen ausging, das hier angeblich vor Gericht stand. Anonyme Zeugen, dubiose Dolmetscher, Behinderung der Öffentlichkeit und der Verteidigung.Man sollte den Blick weg vom Wiener Landesgericht Richtung Straßburg wenden. Dort urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der hatte einmal im Fall „Kostovski gegen die Niederlande“ ein Urteil gefällt, das das Wiener Landesgericht sicherlich kennt. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen sei wichtig und notwendig, heißt es darin. Aber in einem Rechtsstaat gäbe es auch ein eminentes Interesse an einem fairen Gerichts-
verfahren. Das Recht auf ein Verfahren vor einem unabhängigen Gericht habe in einer demokratischen Gesellschaft einen so großen Wert, dass es nicht einer „Zweckmäßigkeit“ geopfert werden dürfe.In anderen Worten: Es geht nicht an, dass Verteidigungsrechte beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf der Strecke bleiben. Ob ein Angeklagter Teil einer Mafiabande ist, das sollte eben eine unbefangene und unhabhängige Justiz klären. Wenn Zeugen anonym bleiben, wenn Dolmetscher mit Wollmützen auftreten, wenn Verteidiger keine wichtigen Fragen stellen dürfen, dann handelt es sich nicht um ein faires Verfahren.
Ich wünsche mir, dass diese Grundsätze nicht nur in Lehrbüchern, Aufsätzen und Kommentaren geheiligt werden, sondern viel mehr dort gelebt werden sind, wo sie hin-
gehören: im Verhandlungssaal. Was Justizministerin Gastinger wohl sagt, wenn sie den neuen Film zur Operation Spring gesehen hat?

 Die anonyme Justiz
Die anonyme Justiz